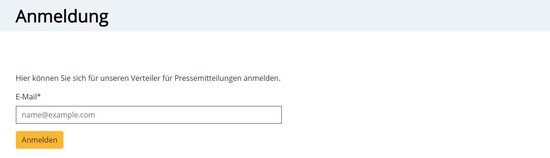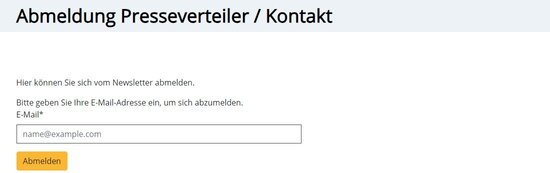Wer heute die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie betritt, trifft auf wunderschöne Altbau-Atmosphäre im grünen Klinikpark mit gemütlichen Gemeinschaftsecken, Wohnküchen, Kreativ- und Sporträumen, Spielmöglichkeiten und Hochbeeten im eigenen Klinikgarten. Nichts erinnert in der Kinder- und Jugendpsychiatrie an eine sterile Krankenhausatmosphäre. Kaum zu glauben, dass das auch vor 75 Jahren schon ein bewusster Ansatz war. Die kleine Kinderbeobachtungsstation, die 1950 ihre Arbeit auf dem Gelände der Städtischen Nervenklinik Bremen (heute Klinikum Bremen-Ost) aufnahm, befand sich ebenfalls in einem Altbau im Klinikpark und bot große Spielzimmer, die liebevoll mit viel Spielzeug, Puppenhaus und Bastelmaterialien ausgestattet waren. Die Station für verhaltensauffällige Kinder hatte schon damals einen psychotherapeutischen Schwerpunkt. Das war fünf Jahre nach Kriegsende eine kleine Sensation. Die Psychotherapie war, gerade in Ärztekreisen, noch wenig anerkannt. Auch die Arbeitsweise der Station, in der die Kinder möglichst ohne Druck und Zwang begleitet und jede Form von „körperlicher Züchtigung“ verboten war, sah mancher zu dieser Zeit noch äußerst kritisch. Die Anmeldungen für die Klinik waren aber von Anfang an hoch. Die Traumata des Krieges wirkten nach. Es gab noch keine niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater und auch nur eine einzige Erziehungsberatungsstelle in ganz Bremen.
„Das damalige Angebot hat trotz innovativer Ansätze mit unserer heutigen Arbeit nicht mehr viel gemein“, sagt Chefarzt Dr. Marc Dupont, der die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,-psychotherapie und-psychosomatik gemeinsam mit seinem ärztlichen Kollegen Frank Forstreuter und den beiden Klinikpflegleiterinnen Nadine Jensen und Nicole Fangmann-Hünken leitet. Einige Jahre später habe es auch für Kinder reine Verwahrstationen ohne therapeutische Angebote gegeben, außerdem seien einige Kinder auf psychiatrischen Erwachsenen-Stationen untergebracht worden.
Das sei heute unvorstellbar. Die in Bremen früh aufgegriffenen psychotherapeutischen Ansätze gäbe es hingegen in aktueller Form noch immer. Die Klinik bietet heute 50 vollstationäre und zusätzlich teilstationäre und ambulante Behandlungsangebote am Klinikum Bremen-Ost und Bremen-Nord und beschäftigt über 200 Mitarbeitende. Das sah 1950 noch ganz anders aus. Die kleine Kinderbeobachtungsstation bot Platz für 15 Mädchen und Jungen zwischen 5 und 14 Jahren. 1962 wurde zusätzlich eine psychiatrische Kinderabteilung mit 15 Betten eingerichtet, 1968 wurde sie dann endgültig zur Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und damit zur selbständigen Abteilung der Nervenklinik.
Im Gegensatz zu den Anfangsjahren hat die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie heute differenzierte Therapieangebote für unterschiedliche Krankheitsbilder und Altersgruppen. Im Zentrum stehen kleine Behandlungsgruppen mit sechs bis sieben Plätzen, um familienähnliche Alltagsbedingungen, verlässliche Strukturen, feste Bezugspersonen und Kontinuität zu bieten. Nach dem Klinikmotto „Jedes Problem hat seine eigene Geschichte und wird besonders gelöst“ erarbeitet ein berufsgruppenübergreifendes, therapeutisches, ärztliches, pädagogisches und pflegerisches Team für jede Patientin und jeden Patienten einen individuellen Behandlungsplan und begleitet durch die Therapie. Dabei werden Familie, Schule und Bezugspersonen ganz bewusst eng eingebunden.
Für schwer kranke junge Menschen steht eine eigene geschützte Akutstation zur Verfügung, für Heranwachsende zwischen 16 und 23 Jahren mit Problemen beim Übergang in die Selbstständigkeit und in das Erwachsenenleben die Adoleszenzstation, die in diesem Jahr auf 15 Behandlungsplätze erweitert werden konnte.
Insgesamt behandelt die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die den alleinigen Versorgungsauftrag für Bremen hat, heute im Jahr rund 2000 Patientinnen und Patienten aus Bremen und den niedersächsischen Umlandgemeinden. Im Laufe der Jahre wurden gemeinsam tragfähige Netzwerke mit niedergelassenen Kinderärzten, Betreuungseinrichtungen und anderen Kinder- und Jugendpsychiatrien in Norddeutschland entwickelt. „Dieser Austausch hilft uns in unserer täglichen Arbeit sehr“, sagt Marc Dupont. Denn noch immer seien die Wartelisten lang und die Nachwirkungen der Pandemie deutlich spürbar.
Den Weg in die Zukunft sieht das Leitungsquartett vor allem in der weiteren Individualisierung der Angebote und darin, gute Antworten auf aktuelle Fragestellungen und komplexer werdende Störungsbilder zu finden. Dabei steht es für das Leitungsteam an oberster Stelle, berufsübergreifend und in enger Abstimmung gemeinsam für die Patientinnen und Patienten tätig zu sein. Bereits vor fünf Jahren hat sich die Klinik außerdem auf den Weg gemacht, Genderfragen aktiv zu aufzugreifen und jungen Menschen einen Unterstützungsraum zu bieten, um dem gewünschten Geschlecht und der eigenen sexuellen Orientierung auf die Spur zu kommen. „Diese Fragestellungen sind bei uns keine Randerscheinung“, so Klinikpflegeleiterin Nadine Jensen. Unterstützt wird die Arbeit der Klinik seit einigen Jahren vom Förderverein „Komma klar“, der sich beispielsweise für spezielle Therapieangebote, therapeutische Spielgräte oder besondere Aktionen für die Patientinnen und Patienten einsetzt, die mit dem Klinikbudget nicht finanzierbar wären.
Und wer sich für die bewegten Anfänge der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bremen interessiert, wird im Krankenhaus-Museum am Klinikum Bremen-Ost fündig. In der Ausstellung „Wahnsinnig?! Psychiatrie – Gesellschaft – Kunst“ ist diesem Thema ein eigener Abschnitt gewidmet.